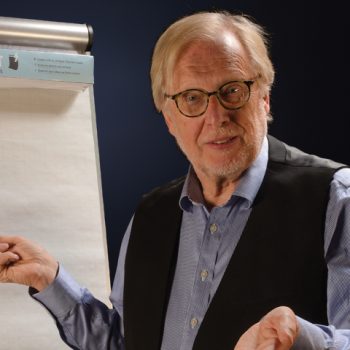Michael Bergediek
Michael Bergediek
Alter: 58 Jahre
Beruf/aktuelle Tätigkeit: Sozialarbeiter
Die meisten Erfahrungen mit anderen Kulturen habe ich in Deutschland gemacht. Zwei Auslandserfahrungen sind mir jedoch gut in Erinnerung. Sie haben mich neben anderen Einflüssen darin bestärkt, in der Begegnung von Kulturen eine Stärkung und Bereicherung zu sehen.
Als ich 17 Jahre alt war, vermittelte unser freundlicher Englischlehrer meinem Bruder und mir eine Gastfamilie in Cliftonville, Kent, Großbritannien. Als empfohlenes Gastgeschenk brachten wir einen bunten Bierhumpen aus Glas mit Zinndeckel mit, der sehr gut ankam. Wir stellten fest, dass wir enorm viele Gemeinsamkeiten hatten: zuhause waren wir zu sechst, Donohoes waren das auch. Wir waren katholisch, sie auch. Wir besuchten dann auch sonntags die Messe zusammen. Wir unternahmen viel zusammen in der Freizeit. Das machten die Kinder der Familie, weil sie Lust dazu hatten. Im Reisepreis war das sicher nicht enthalten. Bewegt hat mich auch, als die Mutter erzählte, wie sie 1940 in London im Bunker saß und Angst hatte, als deutsche Bomben fielen. Ich erinnerte mich, wie meine Eltern mir erzählt hatten, wie sie 1943/44 im Bunker saßen und Angst hatten. Wie sinnlos ist doch Hass und Krieg!
1987 fing ich noch einmal ein zweites Studium an, Germanistik und Anglistik, und war in diesem Rahmen von September 1990 bis März 1991 in Bangor, Wales. Mein Studentenwohnheim war sehr international. Die Uni hatte einen Schwerpunkt in tropischer Forstwirtschaft, daher waren viele afrikanische Studenten dort, aber auch Griechen, Türken, Iraker, Palästinenser, Italiener und viele andere Deutsche. Eine deutsche Kommilitonin hatte durch das Bad in der fremden Sprache und die kulturellen Unterschiede einen Kulturschock. In der Uni gab es ein German Department mit einem Aufenthaltsraum, in dem deutsche Zeitschriften lagen und deutschsprachiges Satellitenfernsehen lief. Dort ging die Studentin morgens hin und nachmittags wieder auf ihr Zimmer. Sie versuchte so zu leben, als ob sie Deutschland nie verlassen hätte. Aber auch ich ertappte mich dabei, ständig zu vergleichen und Dinge in Deutschland besser zu finden.
Sehr interessant war auch die walisische Kultur. Ich besuchte einen Walisischkurs und bekam mit, wie die Waliser versuchten, ihre Traditionen weiterzuführen. Es gab erbitterte Diskussionen darüber, ob Engländer Walisisch lernen müssen, wenn sie in pädagogischen Einrichtungen in Wales unterrichten wollten. Der Kulturkontakt überschnitt sich auch mit dem ersten amerikanischen Irakfeldzug. Fast alle deutschen Studierenden nahmen an der Friedensbewegung teil. Die Versammlungen zur Vorbereitung von Aktionen fanden auf Walisisch statt. In den Zeitungen sah ich Überschriften wie „German wimps“ (deutsche Feiglinge, weil sich die Schröder-Regierung nicht am Irakfeldzug beteiligte). Wenn wir deutsch auf der Straße redeten, wurden wir böse angeguckt. Aber die meisten waren freundlich. Es war eine gute Erfahrung. Besonders in Erinnerung ist mir die Silvesterparty 1990 geblieben. Die mosambikanischen Kommilitonen hatten Besuch von ihrem Freund Antonio und seiner ostdeutschen Lebensgefährtin. Bei der Party tat mir die einzige Frau aus Simbabwe leid, die Englisch sprach. Die Mosambikaner untereinander sprachen Portugiesisch, mit Simone und Antonio sprach ich Deutsch, wenn er auch manchmal seltsame (ostdeutsche) Wörter wie „Broilerklein“ benutzte. Im März war dann die Zeit zu Ende. Was mich immer noch an den Wales-Aufenthalt erinnert, sind Anzeigen zum Blutspenden. Das darf ich nämlich nicht, weil ich länger als ein halbes Jahr in Großbritannien war und bis heute ein Erlass in Kraft ist, der wegen der damaligen übertragbaren Rinderseuche BSE Leute wie mich von der Blutspende ausschließt. Anyway.
Nachdem ich vorher, teilweise parallel zu meiner Sozialarbeit- und später zum Lehramtsstudium im „Förderunterricht für ausländische Schüler an der Universität Essen“ 10 Jahre tätig war, wurde ich im Dezember 1992 Sozialarbeiter für Flüchtlingsbetreuung bei der Stadt Sprockhövel. Ich bin also jetzt hauptamtlich für Flüchtlinge tätig, habe aber vorher auch mehrere Jahre ehrenamtlich in Initiativen mitgearbeitet.
Ein Ansatzpunkt für meine berufliche Orientierung war, als 1977 ein türkischer Student in meine DLRG-Gruppe kam. Damals sprach er nur wenig Deutsch und so traf ich mich privat mit ihm und half ihm beim Lernen. Dabei lernte ich auch sehr viel. Neugierig machte es mich, wenn er mit seinem Onkel Türkisch sprach. Als ich dann 1981 an die Universität Essen zum Sozialarbeitsstudium kam, gab es dort Türkisch-Intensivkurse. Ich stieg dort ein. Neben dem interessanten Lernstoff war der Kurs auch mein Wohlfühlanker im Studium. Während die anderen Veranstaltungen mit 80 Studierenden in fensterlosen Betonräumen stattfanden (jeweils andere 80 in jedem Seminar, kaum jemanden kannte man auch nur flüchtig), saßen 20 Sprachkursteilnehmer zweieinhalb Jahre lang sechs Stunden wöchentlich zusammen. Man kannte nicht nur Namen, sondern auch persönliche Eigenschaften und Telefonnummern. Und wenn einer fehlte, rief man ihn an, gab ihm die Arbeitsblätter und die Hausaufgaben. Später habe ich dann in demselben Rahmen noch Persisch und Kurdisch gelernt, wobei ich mich auf Kurdisch nicht so gut verständigen kann wie in den anderen beiden Sprachen.
In der erwähnten parallelen Förderunterrichtstätigkeit gab ich Unterstützung an Schüler*innen mit Migrationshintergrund, vor allem Latein für türkische Gymnasiast*innen. Auch Gespräche mit den Lehrkräften an den Schulen gehörten dazu. Ich musste feststellen, dass Schüler mit Migrationshintergrund diskriminiert wurden. Wie oft bekam ich zu hören: „Der/die wird die Schule nicht schaffen!“ Später konnte ich die Betroffenen mit ihrem strahlenden Lächeln zum Abitur beglückwünschen. Wie oft beschwerten sich Lehrkräfte über mangelnde Sprachkenntnisse von Schülern, bei denen sie selbst sich nicht die Mühe machten, die richtige Aussprache ihres Namens zu lernen. Bis heute bestehen solche Missstände fort. Ich empfinde es immer noch so, dass das Engagement für Chancengleichheit auf diesem Gebiet sehr mühselig ist, aber lohnend. Meine Berufswahl bereue ich nicht.
Auch für mich persönlich war der Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturen durchgehend eine Bereicherung. Die Begegnung verlief fast immer so, dass ich zu Anfang einem Menschen gegenüberstand, der mir in seinem kulturellen Sosein fremd war, dann aber immer vertrauter wurde. Letztlich haben wir Menschen alle mit denselben Freuden und Sorgen zu leben. Keiner ist mehr oder weniger wert als der andere.
In Sprockhövel finde ich toll, wie viele sich für ein friedliches Zusammenleben engagieren. Das ist wirklich mehr als vorbildlich und überdurchschnittlich. Trotzdem betrachte ich mit Sorge, dass das Thema trotz unveränderter Wichtigkeit doch wieder etwas in den Hintergrund tritt und auch feindliche Tendenzen wieder zugenommen haben. Es ist unser aller Aufgabe, eine integrierte, gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen.
Es muss ausreichend Förderung für Spracherwerb, für Kinder, Jugendliche, Berufsqualifikationen geben. Noch immer heißt es in Schulen: „Hier sind deine Hausaufgaben, wenn du was nicht verstehst, frag deine Eltern.“ Aber was, wenn die es auch nicht wissen, nicht einmal die Frage verstehen?
Der Weg zu einer nichtrassistischen Gesellschaft muss weitergehen. Es darf nicht sein, dass eine freie Wohnung plötzlich vergeben ist, wenn der/die Anrufende einen nichtdeutschen Namen hat.
- Vor Ort kümmern